Entflechtung der Ladeinfrastruktur: Gesetzgeber verlängert Frist – Stadtwerke erhalten Gestaltungsspielraum
Die gesetzlich geforderte Entflechtung der Ladesäuleninfrastruktur stellt kommunale Netzbetreiber vor komplexe Herausforderungen. Mit der Fristverlängerung bis Ende 2026 erhalten De-Minimis-Netzbetreiber mehr Zeit, um rechtssichere, wirtschaftlich tragfähige und steuerlich optimierte Lösungen zu entwickeln. Sponsored Post von KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hintergrund: Was bedeutet Entflechtung?
Die Entflechtung der Ladeinfrastruktur ist Teil der regulatorischen Trennung zwischen Netzbetrieb und wettbewerblichen Tätigkeiten. § 7c EnWG untersagt Elektrizitätsverteilernetzbetreibern künftig das Eigentum, die Entwicklung, den Betrieb und die Verwaltung öffentlicher Ladepunkte. Diese Regelung betrifft auch kleinere kommunale Netzbetreiber, die bislang unter die Ausnahmeregelung des § 118 Abs. 34 EnWG fielen.
Mit dem Beschluss des Gesetzgebers, die Übergangsfrist bis Ende 2026 zu verlängern, wurde auf die praktischen und rechtlichen Herausforderungen reagiert, denen sich viele Stadtwerke gegenübersehen. Die Verlängerung bietet die Möglichkeit, die Entflechtung strategisch und mit der nötigen Sorgfalt umzusetzen.
Begrifflichkeiten und Interpretationsspielräume
Die Begriffe „Entwickeln“, „Betreiben“ und „Verwalten“ sind im Gesetz nur teilweise definiert. Besonders der Begriff „Verwalten“ ist interpretationsbedürftig und wird in der juristischen Literatur unterschiedlich ausgelegt. Diese Unklarheiten haben direkte Auswirkungen auf die Gestaltung zukünftiger Modelle: Welche Dienstleistungen dürfen Netzbetreiber künftig noch erbringen, ohne gegen das Entflechtungsverbot zu verstoßen?
Die Auslegung dieser Begriffe beeinflusst, ob z. B. technische Betriebsführungsleistungen, Wartung oder Monitoring weiterhin durch den Netzbetreiber erbracht werden dürfen – ein entscheidender Punkt für die wirtschaftliche Tragfähigkeit der neuen Struktur.
Strategische Optionen für die Umsetzung
Die Entflechtung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:
- Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern: Verkauf oder Einlage der Ladesäulen in eine andere Gesellschaft. Diese Variante ist vergleichsweise einfach, erfordert jedoch die Zustimmung aller Vertragspartner und kann steuerliche Folgen haben.
- Umwandlungsrechtliche Maßnahmen: Eine Ausgliederung nach Umwandlungsrecht ermöglicht eine Gesamtrechtsnachfolge, bei der bestehende Verträge automatisch übergehen. Diese Lösung ist komplexer, bietet aber Vorteile in der Umsetzung und Rechtssicherheit.
Eine Ausgliederung ist häufig ertragsteuerneutral möglich, aber auch hier sind die Umstände des Einzelfalls entscheidend und sollten im Vorfeld sorgsam geprüft werden.
Die Wahl des Weges hängt vom Umfang der Infrastruktur, den bestehenden Verträgen und den strategischen Zielen des Unternehmens ab. Mit der verlängerten Frist ergeben sich zusätzliche Gestaltungsspielräume, die zuvor nicht vorhanden waren.
Kooperation oder Einzellösung?
Neben der alleinigen Umsetzung besteht die Möglichkeit, sich mit anderen De-Minimis-Netzbetreibern zusammenzuschließen. Kooperationen können Synergien schaffen und Ressourcen bündeln, erfordern aber abgestimmte rechtliche und steuerliche Konzepte. Beide Wege bringen unterschiedliche Folgefragen mit sich – etwa zur Haftung, zur Governance und zur steuerlichen Behandlung gemeinsamer Strukturen.
Rechtliche, steuerliche und organisatorische Fragestellungen
Die Entflechtung wirft eine Vielzahl von Fragen auf, die frühzeitig geklärt werden sollten:
- Rechtsform des neuen Betreibers: GmbH, Anstalt des öffentlichen Rechts oder andere Modelle?
- Fördermittel: Wie werden Zuschüsse behandelt, die in der Vergangenheit für die Ladeinfrastruktur gewährt wurden? Müssen sie zurückgezahlt werden oder können sie übertragen werden?
- Arbeitsrecht: Greift § 613a BGB bei der Übertragung von Personal? Welche Mitbestimmungsrechte sind zu beachten?
- Gesellschaftsrecht: Welche Gremien müssen zustimmen? Wie wird die Kommunalaufsicht eingebunden?
- Externe Partner: Notare, Vertragspartner, Fördermittelgeber – wer muss informiert oder beteiligt werden?
- Steuerrecht: Wie können stille Reserven geschützt werden? Welche Auswirkungen hat die Entflechtung auf Umsatzsteuer, Organschaften und steuerliche Querverbünde? Wie wird die laufende Besteuerung nach der Entflechtung gestaltet?
Besonders für kommunale Unternehmen ist der steuerliche Querverbund ein zentrales Thema. Die Entflechtung darf nicht dazu führen, dass steuerliche Vorteile verloren gehen oder neue Belastungen entstehen.
Formale und zeitliche Anforderungen
Neben den inhaltlichen Fragen müssen auch formale Abläufe beachtet werden. Welche gesellschaftsrechtlichen Gremien müssen eingebunden werden? Welche Fristen gelten für notarielle Beurkundungen, Genehmigungen durch die Kommunalaufsicht oder die Zustimmung von Fördermittelgebern?
Auch steuerlich ist der Zeitplan relevant: Der 31.12.2025 kann z. B. als maßgeblicher Stichtag für die Bildung eines steuerlichen Teilbetriebs gelten, sollte eine Umwandlung im Jahr 2026 geplant sein.
Empfehlung: Jetzt aktiv werden
Auch wenn die Frist bis Ende 2026 verlängert wurde, ist es ratsam, die Entflechtung bereits 2025 aktiv anzugehen. Die Klärung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, die Abstimmung mit internen und externen Beteiligten sowie die Umsetzung der gewählten Struktur benötigen Zeit und Ressourcen.
Ein frühzeitiger Start ermöglicht es, die Entflechtung nicht nur fristgerecht, sondern auch strategisch sinnvoll umzusetzen – und dabei bestehende Synergien zu erhalten, Risiken zu minimieren und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.
Sie haben noch Fragen?
LinkedIn: Vernetzen Sie sich mit
Karl-Hubert Eckerle
Eike Westermann
Website
kpmg.com/de/de/home.html
Noch mehr? Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken!
 LinkedIn VKU KommunalDigital
LinkedIn VKU KommunalDigital

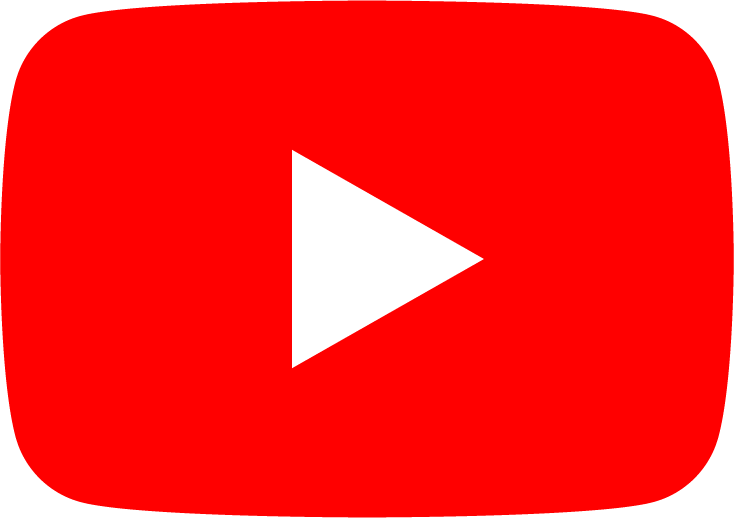 YouTube VKU KommunalDigital
YouTube VKU KommunalDigital
Jetzt Newsletter abonnieren! Bleiben Sie stets informiert
 Newsletter VKU KommunalDigital
Newsletter VKU KommunalDigital

Teaserbild Mediathek © Getty Images / KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Foto Karl-Hubert Eckerle © KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Foto Eike Westermann © KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft




